Dicke Luft im Paradies
Utila, die kleinste der drei Bahia-Inseln, ist reif für den großen Tourismus. Finden viele ihrer Bewohner und die Regierung von Honduras.
Die Einwohner der "Robinson-Crusoe-Insel" im chilenischen Juan Fernandez Archipel müssen jetzt ganz stark sein: Der legendärste aller Schiffbrüchigen ist nicht, wie immer behauptet, an ihren Klippen gestrandet. Sondern über 4000 Kilometer weiter nördlich, in der Karibik, 30 Kilometer vor der Küste von Honduras: Auf Utila.
Davon ist zumindest Shelby McNab überzeugt - und zwar felsenfest: "Da, wo sich jetzt die Flughafenpiste erstreckt, hielten die Kannibalen ihr Mahl ab. Freitag riss sich los und rannte durch die Lagune, über die jetzt die Brücke in die Stadt führt. Robinson, der sich auf Pumpkin Hill verschanzt hatte, konnte von dort oben das Geschehen hervorragend überblicken...."
Der Mann um die fünfzig, der mit seinen Shorts und dem Oberlippenbart an einen ergrauten englischen Pfadfinderführer erinnert, hat keine Zweifel. Schon seit Generationen werde die Geschichte eines Schiffbrüchigen auf der Insel weitererzählt. Als er selbst später zum erstenmal Daniel Defoes Buch in die Hände bekommen habe, sei es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Seitdem organisiert er Rundtouren für Touristen auf den Spuren des einzig wahren Robinson.
Nun gut. Vielleicht muss die Welt in Sachen "Robinson" tatsächlich umdenken. Zumindest aber fügt die abenteuerliche Theorie McNabs dem bunten Bild von Utila einen weiteren Farbtupfer hinzu.
Utila, in seinen Extremen zwölf Kilometer lang, vier Kilometer breit, ist die kleinste der drei "Islas de Bahia", ein flaches, von Magrovensümpfen bedecktes Eiland mit wenigen sandigen Stränden. Berühmt sind Utila, Roatán und Guanaja für ihre Tauchgründe, die neben den Dschungeln des Festlands und den Maya-Ruinen von Copán die dritte touristische Top-Attraktion von Honduras darstellen.
Schon beim Schnorcheln an der Abbruchkante des Riffs, gerade mal fünfzig Meter weit draußen im Meer, erschließt sich die Zauberwelt der Korallen: Zart wiegen sich lila Fächer, erstreckt sich poröses rotes Geäst. Wie ein silberner Torpedo in Zeitlupe zieht ein Barrakuda aufmerksam seine Runden. Schwärme neonblauer Fische schweben und sinken und huschen beiseite wie auf ein geheimes zentrales Kommando. "Wir haben Wracks, wir haben Wände, die hundert Meter steil abfallen, wir haben jede Menge Unterwasserhöhlen", sagt Michael Wildenstein aus Ravensburg, der seit sieben Jahren Tauchschüler das Schweben in der Tiefe lehrt. "Mit einem Wort: Wir haben das komplette Programm." Versteht sich, dass dies auch Muränen umfasst, Karettschildkröten, Adlerrochen, Schwertfische und Walhaie.
Wirbelsturm "Mitch", der im November 1998 in Honduras schlimme Verwüstungen anrichtete, spielte übrigens auch den Riffs im flachen Wasser übel mit. Die 12, 14 Meter hohen Wellen zerschlugen ganz Korallenfelder zu weißem toten Schutt. Im tiefen Bereich aber fegten die bewegten Wasser die Ablagerungen von Jahrzehnten fort und schmirgelten die Korallen wieder blank. Frisches Leben ist eingekehrt, der Fischreichtum hat seitdem enorm zugenommen.
Das Städtchen Utila, die wichtigste Ansiedlung, schmiegt sich hufeisenförmig um eine Bucht. Es zählt etwa 3000 Einwohner und hat sich seinen karibischen Kleinstadtcharme bewahrt. Als Flugpiste dient ein kiesiger Streifen Land. An der schmalen Straße reihen sich alte und jüngere Holzhäuser mit Veranden und Gärten aneinander: Hotel - Cafe - Divingshop heißt in etwa die Reihenfolge, im Zentrum bilden die Werbeschilder der Tauchschulen einen bunten Dschungel: Fast ganz Utila lebt vom Tourismus. Im Buchcafe tauscht ein semmelblonder Braungebrannter "Mörder ohne Gesicht" gegen "Die weiße Löwin", im "Reef Cinema" läuft "Sex Monsters", und vor dem Internet-Cafe fluchen zwei Australier, weil es immer noch renoviert wird. Es riecht nach gebratenem Fisch, junge Frauen mit nassen Haaren schleppen lachend Taucheranzüge in ihr Hotel und auf einer Bank im Schatten sitzen aufgereiht verschlossen blickende Jugendliche mit bronzener Haut und abgerissenen Klamotten.
Vor zwanzig Jahren sah das alles noch etwas anders aus. Da lebten die Menschen auf Utila vom Fischfang, verdingten sich auf Öltankern oder arbeiteten im Ausland. Als Gäste kamen ganz selten ein paar Kumpel, die die Seeleute auf den Schiffen kennengelernt hatten. Zu Beginn der 90er Jahre änderte sich das. Europas junge Globetrotter, immer auf der Suche nach verschwiegenen Flecken zum Relaxen, entdeckten Utila für sich. Es war ein Backpackerparadies: Wasser und Sonne satt, billig, friedlich, abgelegen - und an die etwas lockereren Sitten würde sich die überwiegend streng methodistische Inselgemeinschaft schon noch gewöhnen. So wie sie selbst mit den Sandfliegen fertigwerden mussten, deren Stiche die Haut zum Kochen bringen, wenn der Nordostwind sie nicht mehr in Schach hält.
Für die Utilenos war das etwas Neues: Geld zu verdienen, während man zuhause blieb. Wer konnte, räumte eine Kammer leer, stellte ein paar Tische auf oder machte ein Boot klar. Die Tauchschulen dagegen wurden überwiegend von Ausländern gegründet. Zehn davon gibt es mittlerweile.
Morgens um sieben geht es noch ruhig zu in Utila. In "Fourwheelers", kleinen Flitzern mit großen Reifen, bringen Mütter ihren Nachwuchs zum Kindergarten, schwarze Frauen waschen Häuserstufen und weißhaarige Männer mit wetter- wie alkoholzerfurchten Gesichtern köpfen schon mal ihr erstes Bier.
Die Insel hat viele Völker kommen und gehen sehen: Indianische Ureinwohner, spanische Konquistadoren, holländische Piraten. Schwarze Sklaven, die Garifunas, flüchteten sich im 18. Jahrhundert hierher, im 19. landete ein Schwung britischer Siedler von den Cayman-Inseln.
Es sind aufgeschlossene Zeitgenossen, kein Problem, jemanden für ein kleines Schwätzchen zu finden. Schon schwieriger ist es, das kehlige Englisch zu verstehen, das an einen afrikanischen Dialekt erinnert. An Themen dagegen herrscht kein Mangel. Denn im karibischen Paradies herrscht dicke Luft.
Zum einen sind da neben den willkommenen die ungeliebten Gäste: "Mainlanders", Leute vom Festland. Je mehr Touristen die Inseln besuchten, desto phantastischere Berichte über sagenhafte Verdienstmöglichkeiten kreisten im armen Honduras. Viele kamen, um ihr Glück zu machen, Hunderte sind geblieben. Sie leben abseits der touristischen Meile in zwei Slums, "Sumpfdorf" heißt eines nicht ganz unzutreffend.
Arbeit gibt es nur wenig. Und also kamen mit ihnen Probleme, die Utila bis dahin nicht gekannt hatte: Diebstähle, Raub, sogar Mord. Das bringt die Inselbewohner auf die Palme: 1861 waren die Bahia-Inseln von den Briten an Honduras übergeben worden - fast scheint es in manchen Gesprächen, als brächen sich jetzt uralte Vorurteile gegen die fremden Landsleute wieder Bahn.
Noch ganz andere, unerwartete Schwierigkeiten tun sich auf. Shelby McNab ist zugleich Vorsitzender der Bay Islands Conservation Association (BICA). Neben dem Erhalt der Riffe kümmert sich die Naturschutzorganisation vor allem um den Schutz des Schwarzleguans und arbeitet dazu mit einem Projekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt zusammen, in dem Jungtiere aufgezogen und ausgesetzt werden. "Wir hatten unsere eigenen Leute schon so weit, dass sie nur noch die nicht gefährdeten grünen Leguane jagten", sagt McNab. "Und immer nur den einen, den sie für eine Mahlzeit brauchten. Die Mainlander dagegen jagen alles, Leguane wie Schildkröten, und soviele davon, wie sie kriegen können."
Was tun? "Erziehung", meint McNab. "Integration. In diesem Jahr kriegen wir erstmals 98 % der Mainlander-Kinder in die Schule". Er selbst veranstaltet Fußballturniere mit Jugendlichen, auch denen aus den Slums. Der Bürgermeister erlässt scharfe Gesetze zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung.
Weit mehr als die Ausrottung der Leguane befürchten die Inselbewohner jedoch, dass ihre ungeliebten Mitbewohner die Touristen vergraulen könnten - und zwar die von morgen.
Denn mit dem finanziellen Erfolg sind ihre Bedürfnisse gewachsen. Noch gibt es kein Abwassersystem auf der Insel. Der Müll wird offen verbrannt. Strom erzeugt ein Generator - von fünf Uhr morgens bis Mitternacht. Fortschritt aber kostet Geld, mehr Geld als die 25-Dollar-am-Tag-Touristen bringen. Die 200-Dollar-Leute sollen jetzt kommen, Kreuzfahrer in Massen, die einmal über die Insel bummeln und die Souvenirläden leerkaufen. Noch lieber aber wären ihnen die vielumworbenen 500-Dollar-Leute: die sagenumwobenen Bewohner der Luxushotels. "Unsere jungen Leute brauchen Karrieremöglichkeiten", sagt der geschmeidige junge Angestellte im Maklerbüro. "Kellner oder Verkäufer im Tauchshop zu werden, ist schließlich keine Perspektive." Und fährt fort, von den neuerdings so glänzenden Geschäften der Firma zu schwärmen.
In der Tat: Vom Boot aus betrachtet, ist nicht zu übersehen, dass der Ausverkauf der Insel schon begonnen hat. An abgelegenen Strandstücken mit weißem Sand entstehen unter Palmen feine Ressorts aus rotem Holz und viel Glas, Luxusenklaven für Betuchte, mit eigenem Bootssteg und dem Riff vor der Haustür
Und dann ist da noch der neue Flughafen: Wer auf den holprigen Pfaden ins Innere der Insel wandert, stößt plötzlich auf eine etwa 200 Meter breite, vielleicht 1500 Meter lange kahle Schneise - ganz so, als hätte jemand mal schnell einen riesigen Rasenmäher ausprobiert. Als nach "Mitch" die internationale Hilfe für Honduras anlief, gab auch Schweden Geld, angeblich für den Ausbau des Flugverkehrs auf Utila. Und also begann im Januar dieses Jahres ein Trupp Bulldozer, per Schiff vom Festland herübergebracht, mit den Rodungsarbeiten - gegen den erklärten Willen mehrerer Landbesitzer. Inwieweit der Bürgermeister in die Affäre verwickelt ist, bleibt offen. Ebenso, wer denn nun - ganz oben in der honduranischen Regierung - den goldenen Schnitt gemacht hat. Zusätzlich wurde eine Trasse zur Stadt gelegt, die eine vierspurige Straße aufnehmen kann - sicher nicht für die wenigen Pick-Ups der Inselbewohner. Mit einem Wort: Die stille Enteignung der Leute von Utila hat begonnen.
Eine Hoffnung bleibt ihnen freilich: Es könnten, wie schon so oft, am Ende doch die Mittel fehlen, das Werk der Gigantomanie zu vollenden.
Bradford Duncan, eine der schillerndsten Gestalten Utilas, steht als leuchtendes Beispiel dafür. Anfang der 90er Jahre ernannte er sich, nur halb im Spaß, zum Gouverneur, und begann, mit sieben Millionen eigenen und geliehenen Dollar, einen standesgemäßen Palast zu bauen: ein Luxushotel vom Feinsten. Er ging bankrott. "Duncans Folly", ein eleganter Turm aus Teak aber thront noch immer zugenagelt auf seinem Hügel über Sandy Bay und überragt hybrid die Stadt. Wenn Honduras
doch nur seine Denkmäler ernst nehmen würde.
- zurück -
Startseite
Frisch in Arbeit
Die taz-Kolumne
Blätterwald
Weltweit
Ländersache
Themenwahl
FundstückThemenwahl
Vom Meer
Über Land
Bei Leuten
Am Berg
Nach Norden
Klein und fein
Ganz fern
Mahlzeit
In Städten
Auf Inseln
Am Wasser
Schnee und Eis
Lehrstunden
Ganz natürlich
Tropenhitze
Serienweise Über Land
Bei Leuten
Am Berg
Nach Norden
Klein und fein
Ganz fern
Mahlzeit
In Städten
Auf Inseln
Am Wasser
Schnee und Eis
Lehrstunden
Ganz natürlich
Tropenhitze
Buch & Beifall
Post
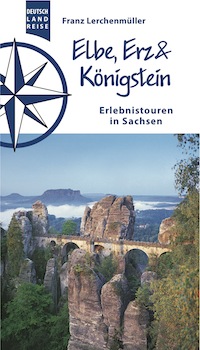
Mehr unter Frisch in Arbeit.
Rezensionen unter Buch & Beifall - Gut gefunden



